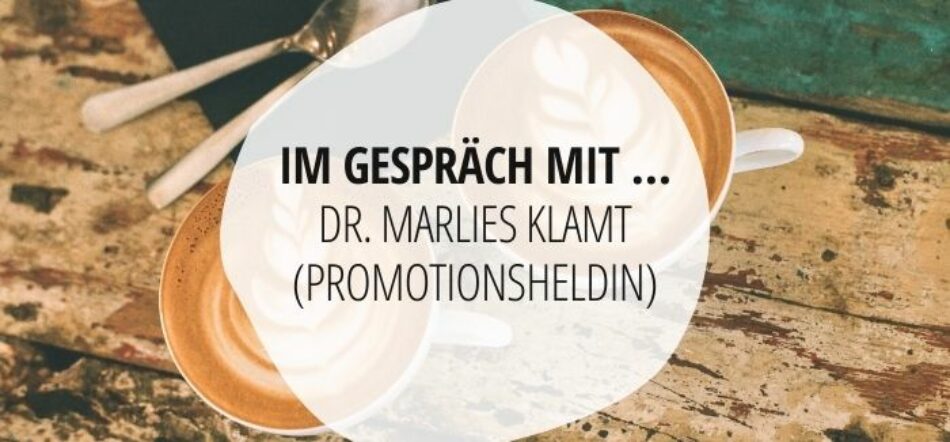
Im Gespräch mit … Dr. Marlies Klamt (Promotionsheldin)
Bei mir zu Gast ist heute Promotionsheldin Dr. Marlies Klamt, die als Promotionscoachin Doktorandinnen dabei unterstützt, ihren Weg zu einer glücklichen Promotion zu finden. Denn dieser Weg – der ist nicht immer einfach. Die Erfahrungen, die Marlies selbst in ihrer Promotion gemacht hat, bestätigen das…
ABER es gibt Hoffnung 😉
Wie Marlies nämlich den Weg aus dem Promotionsfrust zum erfolgreichen Abschluss geschafft hat, was ihr am meisten dabei geholfen hat und wie auch DU endlich die Zügel deiner Promotion in die Hand nimmst – das erfährst du hier!
Vom Promotionsfrust zum erfolgreichen Abschluss
1.) Marlies, du hast selbst eine Promotion durchlaufen – aber das waren nicht immer nur rosige Zeiten. Womit hast du denn am meisten gekämpft? Was fandest du persönlich am herausforderndsten in der Promotion?
Puh, während meiner Promotion gab es so viele Herausforderungen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll – viele davon kommen übrigens bei fast jeder Promotion vor, da war meine kein Einzelfall. Etwa, dass ich verschiedene Baustellen unter einen Hut bringen musste: meine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut mit Lehrverpflichtung; meine freiberufliche Tätigkeit als Videojournalistin und Cutterin; und die Dissertation selbst. Dazu kamen dann noch zeitintensive Hobbys wie Paddeln und Reiten und dass ich ehrenamtlich in der Antidiskriminierungsarbeit aktiv war. Das alles zeitlich unterzubringen, war wirklich nicht einfach.
Ein spezifischeres Problem meiner Dissertation war, dass ich interdisziplinär promoviert habe. Deshalb musste ich mich in verschiedene Methoden, Theorien und Ansätze einarbeiten, mit denen ich teilweise im Studium noch gar nichts zu tun gehabt hatte. Das ist zwar spannend, kostet aber auch Zeit und Energie und hat teilweise dazu geführt, dass ich mich etwas als Außenseiterin gefühlt habe, was bei interdisziplinären Arbeiten nicht selten ist – man passt halt in keine Schublade mehr so richtig rein und das erfordert ziemliche Offenheit bei Wissenschaftler*innen, die nur in einer der Disziplinen, in denen ich unterwegs war, zu Hause sind.
Wahrscheinlich der frustrierendste Moment meiner gesamten Promotionszeit war, als ich schon 200 Seiten geschrieben hatte und dachte, ich stände kurz vor der Abgabe. Mein Doktorvater hat mir dann freundlich, aber bestimmt mitgeteilt, dass „das so noch nicht geht“. Statt mich an die mühsame Überarbeitung von 200 Seiten zu machen, habe ich mir ein paar Monate Zeit genommen und mich noch mal grundsätzlich neu strukturiert. Mein Thema habe ich nicht geändert, aber die Forschungsfrage geschärft und die Gliederung neu aufgesetzt. Im zweiten Anlauf habe ich die Arbeit dann in neun Monaten runtergeschrieben. Von den 200 Seiten, die ich schon geschrieben hatte, habe ich am Ende nichts verwendet.
Du verlierst dich gefühlt von Tag zu Tag mehr in deinem eigenen Dissertationsprojekt? Keine Panik!
Mit meinem bewährten 3-SCHRITTE-PLAN konzipierst du ein Forschungsvorhaben, das auf das Wesentliche fokussiert UND zielgerichtet umsetzbar ist!
2.) Wow, da hast du ja eine beachtliche Kehrtwende hingelegt! Wie konntest du denn im zweiten Anlauf dieses „Mehr“ an Struktur und Fokus in deine Promotion bringen?
Als ich die Arbeit im zweiten Anlauf noch mal neu angefangen habe, war mir klar, dass ich zügig fertig werden will. Mein Vertrag an der Uni war kurz vor dem Auslaufen und ehrlich gesagt hatte ich auch keine Energie mehr, noch mal ein paar Jahre mehr dran zu sitzen. Ich habe also angefangen, die Doktorarbeit mehr wie ein Projekt zu behandeln, dass ich manage und weniger wie dieses heilige Buch, das ich schreibe und in dem ich die Wissenschaft neu erfinden muss – das ist im Übrigen ja auch gar nicht der Anspruch an eine Dissertation, sondern es geht „nur“ darum, zu zeigen, dass du eigenständig wissenschaftlich arbeiten und forschen kannst.
Die größte Veränderung, die ich eingeführt habe, war ein neuer Umgang mit meiner Zeit. Ich wollte zügig vorankommen, aber mich gleichzeitig nicht in den Burnout befördern und auch nicht auf Freizeit und Hobbys verzichten. Es war also klar, dass ich die Zeit, die mir zur Verfügung stand, produktiver würde nutzen müssen. Außerdem wusste ich, dass ich beständig an der Diss dranbleiben muss und es mir nicht leisten können würde, während des Semesters, wenn wegen der Lehre viel zu tun war, fast gar nichts mehr für die Diss zu machen.
Es war wirklich erstaunlich: In meinem letzten Promotionsjahr habe ich zwar in Bezug auf reine Zeitstunden nicht mehr für die Doktorarbeit gemacht als vorher, aber ich war deutlich fokussierter und bin wesentlich schneller vorangekommen. Das motiviert natürlich ungemein und so hatte ich plötzlich auch wieder Spaß an der Doktorarbeit. Ich hatte endlich einen nachhaltigen, funktionierenden Rhythmus gefunden und hatte nicht nur freie Zeiten, sondern konnte die auch ohne schlechtes Gewissen genießen. Ich war in dem Jahr vor der Abgabe auf Wildwasserflüssen in Slowenien, Frankreich und der Schweiz paddeln und hatte eine Reitbeteiligung. Ich habe fast gar nicht mehr am Wochenende gearbeitet und habe Urlaub gehabt.
Einer der wirksamsten Hebel war sicherlich, ganz klar zu entscheiden, dass die Dissertation meine Priorität sein wird. Das hatte dann zum Beispiel zur Konsequenz, dass ich nicht mehr abends nach der Arbeit versucht habe, was für die Doktorarbeit zu machen, sondern mich bereits morgens als erstes drangesetzt habe. Ich wusste schon, dass ich vormittags geistig am fittesten bin und hab versucht, diese Zeit so oft wie möglich für die Dissertation zu nutzen.
Ich bekomme das auch immer wieder in der Arbeit mit Doktorandinnen mit – wenn sie ihre produktivsten Arbeitszeiten für die Diss nutzen (und die müssen nicht wie bei mir morgens liegen), dann schaffen sie plötzlich doppelt so viel in der Hälfte der Zeit!
Und noch eine andere ganz konkrete Veränderung: Ich habe angefangen, jeden Tag mindestens 15 Minuten was für die Promotion zu machen. Dadurch war die Dissertation ständig präsent und auch an den Tagen, an denen ich nur eine Viertelstunde dran saß, bin ich zumindest in Mäuseschrittchen vorangekommen und nicht wieder zurückgefallen, weil plötzlich doch ein, zwei oder mehr Wochen vergangen sind und ich nicht mehr wusste, wo ich das letzte Mal genau dran gearbeitet hatte. Ich habe das die 15-Minuten-Regel genannt und so simpel sie auch klingt, so gut funktioniert sie.
3.) Heute begleitest du als Promotionscoachin Promovendinnen dabei, ihr eigenes Promotions-Traumleben zu gestalten und mit Struktur und Freude die Promotion zu verfolgen: was ist dir denn in deiner Arbeit besonders wichtig weiterzugeben oder zu vermitteln?
Für mich hat mein letztes Promotionsjahr wirklich zu einem Aha-Effekt geführt: Ja, es geht, man kann glücklich promovieren. Du musst dich nicht aufarbeiten und ständig am Limit sein, sondern du kannst eine solide wissenschaftliche Arbeit schreiben und dennoch noch ein Privatleben haben. Wir bekommen ja implizit vorgelebt, dass wissenschaftliche Arbeit immer hart sein muss. Der Glaubenssatz, dass wir es nur dann gut machen, wenn wir uns aufarbeiten, hat oft fatale Konsequenzen. Und das Absurde daran ist: Es ist halt nicht mal der effizienteste Weg.
Ich bin zum Beispiel zutiefst davon überzeugt, dass uns Pausen produktiver sein lassen. Nur wenn du deine Batterien regelmäßig auflädst, bist du bei der nächsten Arbeitseinheit geistig wieder voll da. Aber da sind wir gesellschaftlich so stark davon geprägt, dass es wirklich schwer ist, von diesem „Mehr Arbeit = besser“ wegzukommen.
Die Idee, regelmäßig eine volle 40-Stunden-Woche für die Promotion aufzubringen, finde ich zum Beispiel einfach unrealistisch. Das geht vielleicht mal, wenn du einen Vortrag vorbereitest oder ein Paper abgeben musst, aber als Hausnummer für einen nachhaltigen Arbeitsrhythmus finde ich das zu viel. Fast alle Aufgaben, die für eine Dissertation anfallen, sind Hochkonzentrationsaufgaben und die kannst du nicht acht Stunden am Stück machen. Da finde ich es auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass unsere 40-Stunden-Woche ja ursprünglich aus dem industriellen Zeitalter stammt. Da ging es um Fließbandarbeit in Fabriken. Das ist sicher harte Arbeit, aber nicht mit den Erfordernissen einer Doktorarbeit vergleichbar.
Statt jetzt irgendwie zu versuchen, auf Biegen und Brechen auf 40 Stunden zu kommen, finde ich es viel zielführender, den Fokus daraufzulegen, in wenig Zeit viel zu schaffen und ein ausgeglichenes (Work)-Life-Diss-Verhältnis zu haben. Es geht also darum, mehr in Output zu denken und weniger in Zeitstunden, die erfüllt werden müssen. Und sich selbst erst mal an den Gedanken zu gewöhnen: „Ja, die Promotion darf sich auch leicht anfühlen! Meine Arbeit ist nicht weniger wert, wenn ich Spaß daran habe und wenn ich auch noch ein Leben neben der Diss habe.“
4.) Die Promotion als Erfahrung, die sich leicht anfühlen und Spaß machen darf – ich könnte mir vorstellen, das hört sich für viele DoktorandInnen nach ferner Utopie an. Aber welcher (Denk-)Fehler steht Promovierenden am häufigsten im Weg, um sich ein erfülltes, motiviertes Promotionsleben zu gestalten?
Einer der häufigsten Fehler ist sicher das, was ich gerade schon beschrieben habe: zu denken, dass mehr (arbeiten) besser ist und die Promotion nur dann gut werden kann, wenn ich Tag und Nacht daran sitze und keine Grenzen kenne.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Phänomen, das sich vielleicht erst mal widersprüchlich anhört, aber den Ursprung ebenfalls in Glaubensätzen hat, die durch unsere vorherrschende Arbeitskultur hervorgebracht werden. Dieses Phänomen tritt vor allem bei den Promovierenden auf, die neben der Promotion noch an der Uni arbeiten: Sie investieren so viel Zeit und Energie in ihren Job an der Uni, dass daneben kaum mehr Zeit für die eigene Forschung bleibt und die Doktorarbeit immer an letzter Stelle kommt.
Ich kann das aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen: Bei der Arbeit bekommst du Deadlines vorgegeben, es gibt eine Kontrolle von außen (es fällt auf, wenn du etwas nicht pünktlich erledigst) und du bekommst Anerkennung, wenn du etwas gut gemacht hast, zum Beispiel Feedback von Studierenden für eine Lehrveranstaltung oder ein Lob von der Chefin für die Organisation von einem Projekt.
All diese Dinge fehlen bei der Doktorarbeit im Regelfall: Gerade bei geistes- und sozialwissenschaftlichen Arbeiten weiß selten überhaupt jemand, was du da im stillen Kämmerlein so machst. Betreuer*innen von Dissertationen haben oft weder Zeit noch Lust, den Fortschritt ihrer Doktorand*innen abzufragen, sondern erwarten eher, dass diese sich bei ihnen melden, wenn sie neue Erkenntnisse haben. Lob und Anerkennung gibt es auch selten – wenn wir uns dann mal trauen, ein Kapitel abzuschicken, gibt es meistens eher Feedback in Form von Kritik.
Das ist aus Sicht der Doktormutter/des Doktorvaters, die dabei unterstützen wollen, die Arbeit zu verbessern, zwar nachvollziehbar, aber verunsichert die Promovend*in, die monatelang daran gesessen hat und sich oft sehr stark mit der Doktorarbeit identifiziert, gleichzeitig aber nicht weiß, ob das, was sie da tut, überhaupt gut genug ist (das berühmte Imposter-Syndrom), noch mehr.
Es ist als kein Wunder, dass wir uns häufig auf die Arbeit am Institut stürzen (und davon gibt es ja stets genug) und die Dissertation immer weiter aufschieben.
Was du dagegen tun kannst, ist, dir erst einmal bewusst darüber zu werden, dass niemand sich für unsere Doktorarbeit verantwortlich fühlen wird und wir das selbst tun müssen. Dazu gehört dann auch Grenzen zu ziehen, der Arbeit und den Chef*innen gegenüber, die oft auch noch gleichzeitig die Doktorarbeit betreuen. Wenn du es dann auch noch schaffst, weniger, aber effektiver und effizienter zu arbeiten, steht einem erfüllten Promotionsleben mit guter Work-Life-Diss-Balance nichts mehr im Wege.
5.) Das klingt ja gut 😉 Denn auch viele meiner KundInnen kämpfen immer wieder mit ihren Promotionsprojekten! Was empfiehlst du ihnen als ersten Schritt, um die Promotion richtig in den Griff zu bekommen und besser zu strukturieren?
Die Promotion ist ein riesiges Projekt und fast immer das erste Projekt in dieser Größenordnung, das wir – zudem noch alleine – managen müssen. Da Struktur hereinzubringen und sich gut zu sortieren, ist nicht einfach. Ich bin ja ein Fan von Effizienz und liebe Dinge, die in kurzer Zeit Resultate bringen, weshalb ich Doktorand*innen, die ihre Doktorarbeit in den Griff bekommen und mehr Struktur in ihr Promotionsleben bringen wollen, empfehle, das mit Unterstützung anzugehen.
Genau dafür habe ich den Kurs „Promotion mit Plan. Struktur und Spaß im (Promotions-)Leben“ kreiert. Da erkläre ich Schritt für Schritt, wie du es schaffst, fortan den Überblick über dein Promotionsprojekt zu behalten und wie du spürbar vorankommst, ohne auf Pausen und Freizeit zu verzichten.
Den Kurs gibt es in verschiedenen Varianten: als reinen Selbstlernkurs, als Gruppen-Programm zusammen mit anderen Doktorandinnen mit wöchentlichen Treffen mit mir und als Variante mit 1:1 Begleitung durch mich.
Das Gruppen-Programm findet zwei Mal im Jahr statt und die nächste Runde startet am 20. April 2022. Doktorandinnen kann ich dieses Programm besonders ans Herz legen, weil es eine tolle Community von promovierenden Frauen gibt, mit denen du dich jederzeit auf unserer Community-Plattform austauschen oder aber im Coworking-Raum zum gemeinsamen Arbeiten an der Diss treffen kannst – das ist oft nicht nur viel produktiver, als alleine dran zu sitzen, sondern macht auch noch mehr Spaß!
Ich danke dir, Marlies, für deine Offenheit und die wertvollen Tipps und Strategien, die du hier mit uns geteilt hast!
